Mehr Konkurrenz für deutsche Lammfleischerzeuger?
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland sei ein geopolitisches Signal, betonte Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, bei der Unterzeichnung am 30. Juni in Brüssel. Noch am gleichen Tag gab es seitens der europäischen Landwirte Proteste. So demonstrierten in Brüssel französische Viehzüchter gegen die Erhöhung der Einfuhrquoten für Lammfleisch aus Neuseeland.
- Veröffentlicht am
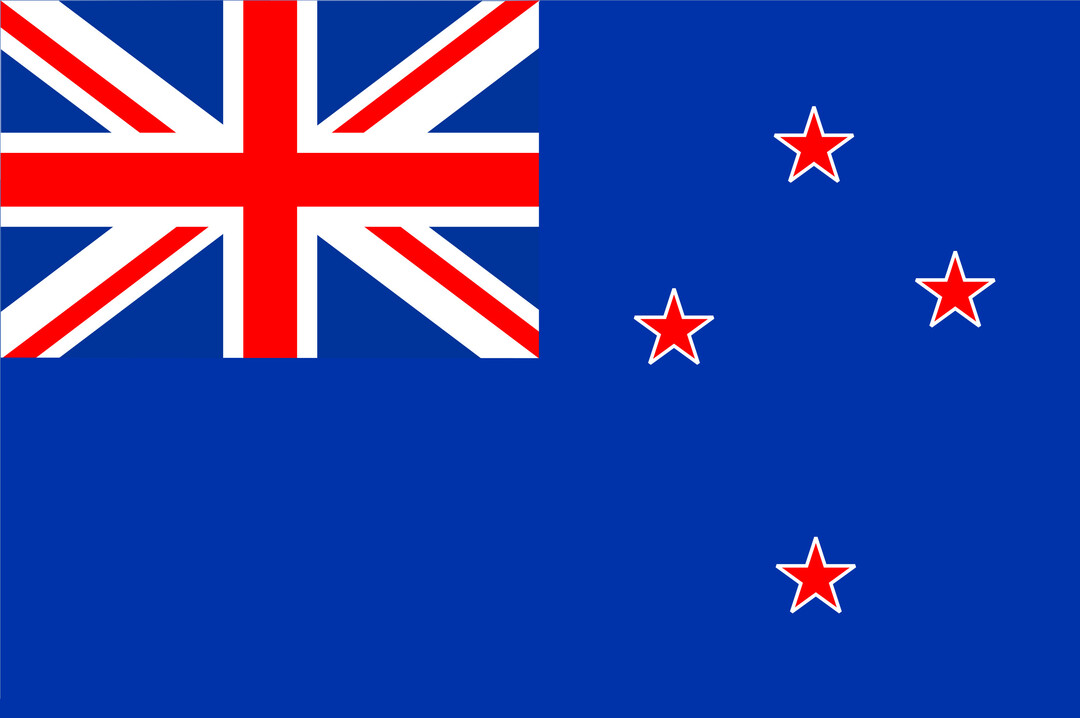
Denn die Preise für neuseeländisches Lammfleisch würden rund ein Drittel dessen betragen, was Lammfleisch von französischen Erzeugern kostet.
Für Schaffleisch wurde Neuseeland, bei schrittweiser siebenjähriger Anhebung, eine Erhöhung der zollfreien Importmenge um 38 000 t Schlachtkörperäquivalent eingeräumt. Dazu hieß es aus der EU-Kommission, dass der Handelspartner seine derzeitige Importquote von 126 000 t Schaffleisch bisher sowieso nicht ausschöpfe.
Kaum zusätzliche Absatzmöglichkeiten für deutsche Landwirtschaft
Die bekanntgewordenen Ergebnisse würden die europäischen Milchvieh- und Schafhalter vor zusätzliche massive Herausforderungen stellen, erklärte Karsten Schmal, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. "Unserer Landwirtschaft bieten sich kaum zusätzliche Absatzmöglichkeiten. In den zurückliegenden Monaten wurde deutlich, wie unverzichtbar stabile regionale Lieferketten sind und dass diese auch geschützt werden müssen.“
Unterdessen erklärte der Generalsekretär der EU-Ausschüsse der Bauernverbände (COPA) und ländlichen Genossenschaften (COGECA), Pekka Pesonen, es werde begrüßt, dass die europäischen Produktionsstandards - zum Beispiel hormonfreies Rindfleisch - und die geografischen Angaben von Neuseeland anerkannt worden seien. Zudem lobte er die Verpflichtungen, die sowohl die EU als auch Neuseeland in Bezug auf die Einbeziehung der Grundsätze des Pariser Klimaabkommens und der Nachhaltigkeit in den internationalen Handel eingegangen seien.
Forderung nach Überwachung der Einfuhrkontingente
Allerdings kritisierte auch der Finne, dass die Übereinkunft für Schlüsselsektoren wie die Milch-, Schaf- und Rindfleischproduktion schmerzhaft sei. Vor diesem Hintergrund mahnte Pesonen eine ordnungsgemäße Verwaltung und Überwachung der Einfuhrzollkontingente von Agrarerzeugnissen, „um ein Marktversagen zu vermeiden“.
Demgegenüber bezeichnete der neuseeländische Branchenverband Beef+Lamb New Zealand (B+LNZ) die Zugeständnisse der Europäischen Union als enttäuschend. Es gebe nur einen sehr beschränkten Zugang zum großen und attraktiven europäischen Markt. Die neuseeländische Regierung verteidigte die Einigung dagegen. Sie sprach von handfesten Zuwächsen in einem restriktiven Markt.
Handelsübereinkunft nach Zustimmung durch den Europäischen Rat
Seit Mitte 2018 führten die Europäische Union und Neuseeland Gespräche zu dem Freihandelsabkommen. Ziel ist es, den Handel von Waren und Dienstleistungen der beiden Partner um 30 % zu steigern.
Die ausgehandelten Entwürfe sollen nun in Kürze veröffentlicht werden. Nach Abschluss der sogenannten „Rechtsförmlichkeitsprüfung“ wird der Entwurf in alle Amtssprachen der EU übersetzt. Im Anschluss wird die Kommission das Abkommen dem Rat zur Unterzeichnung und zum Abschluss übermitteln.
Nach der Annahme durch diesen können die EU und Neuseeland die Handelsübereinkunft unterzeichnen. Nach der Unterzeichnung wird der Text an das Europaparlament übermittelt. Nach dessen Zustimmung und der Ratifizierung durch Neuseeland kann das Abkommen schließlich in Kraft treten.


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.